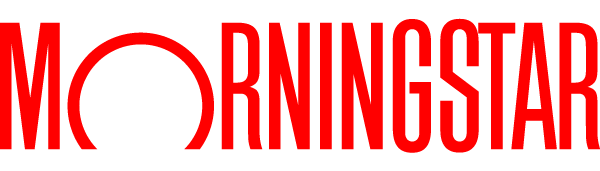Die Debatte um einheitliche ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verwirrt oder schreckt Anleger ab. Die jahrzehntealte Atomdebatte zeigt jedoch das Ausmaß der Herausforderung für Standardsetzer.
Es gibt kein weltweit anerkanntes Konzept für nachhaltiges Investieren. Zahlreiche Regulierungen und Ziele von UN, EU, SEC, BaFin und AMF sowie Organisationen wie die SASB oder die IFRS Foundation sind vorhanden. Dennoch fehlt ein einheitlicher Standard.
Doch mit jeder neuen Initiative, jedem Gesetz oder Benchmark von internationalen Gremien versuchen Anleger, sich anzupassen. Indexanbieter und ETF-Emittenten bedienen diese Nachfrage. Schwierig wird es bei kontroversen Themen wie der Rolle von Fossilen Brennstoffen und Atomkraft in der Energiewende. Hier müssen ETF-Anbieter raten, wie Anleger auf die Aufnahme oder den Ausschluss bestimmter Sektoren reagieren.
Das Ergebnis ist ein fragmentierter Markt mit unterschiedlichen Ansichten und Produkten. Sie verfolgen zwar ein ähnliches Ziel, doch die Wege dorthin sind umstritten. Dies zeigt sich deutlich bei der Atomenergie. Kenneth Lamont, Senior Analyst für passive Strategien bei Morningstar, sieht hier wertebasierte Diskussionen, die die Märkte bewegen.
„Es ist politisch brisant“, sagt Lamont. „Viele Länder lehnen Atomkraft in nachhaltigen Portfolios ab. Die Rolle ist stark umstritten und politisiert – weit über den Investmentbereich hinaus. Der Investmentbereich spiegelt lediglich die globalen Konfliktideen zu Atomkraft wider.“
Startrampe Nachhaltigkeit
Für ESG-Grenzzieher problematisch: Befürworter und Gegner der Atomkraft haben stichhaltige Argumente. Nur wenige Industrien haben vergleichbare positive und negative Auswirkungen.
Prominente Fehlschläge haben die Reputation belastet und den politischen Willen zur Erneuerung der Atomkapazitäten gedämpft. Daten von Robeco zeigen: Der globale Atomstromanteil sank bis 2018 um 3,5 %. Dies wird sich laut Robeco beschleunigen. Europa hat 2040 voraussichtlich nur noch 35 % der aktuellen Kapazität, die USA 56 %.
Negative Stimmung treibt Ereignisse wie Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011). Tschernobyl tötete 31 Menschen direkt; bis zu 27.000 Todesfälle in Europa werden durch Krebs und Missbildungen vermutet. Nach Fukushima evakuierten 154.000 Menschen. Deutschland schaltete 2022 alle 17 Atomkraftwerke ab.
Auch im Betrieb sind Atomreaktoren ressourcenintensiv und riskant. US-Reaktoren verbrauchten 2015 laut Stanford 320 Milliarden Gallonen Wasser. Mehr als 250.000 Tonnen radioaktiver Abfall lagern weltweit und warten auf geologische Endlager.
Greenpeace lehnt Atomkraft als Weg für die grüne Transformation ab: „Neue Atomkraftwerke sind teurer und langwieriger als Erneuerbare wie Wind oder Solar. Wir brauchen schnelle und bezahlbare Lösungen gegen den Klimawandel.“
„Atomkraft ist beides nicht. Es gibt keine sichere Lösung für radioaktive Abfälle. Jede Deponie in den USA leckt Strahlung. Atomkraftwerke gehen die Lagerkapazitäten für strahlende Abfälle aus.“
Andere argumentieren: Atomkraft ist zwar nicht ideal, aber im Energiemix notwendig. Ein IPCC-Bericht (2014) zeigte: Kernenergie benötigt weniger Land, weniger Materialabbau, produziert weniger Abfall und vier Mal weniger CO2 als Solarfarmen.
Ein Befürworter ist der Wissenschaftler James Lovelock, Schöpfer der Gaia-Hypothese und Mitglied von Environmentalists for Nuclear.
Lovelock 2004: „Setzen wir Erneuerbare sinnvoll ein. Doch nur Atomenergie verursacht keine globale Erwärmung.“
„Erneuerbare wie Wind, Wasser und Biomasse schädigen die Umwelt stark, um den globalen Energiebedarf zu decken. Gemessen in Watt pro Quadratmeter hat Atomkraft astronomische Vorteile.“
„Wir haben keine Zeit für Experimente. Die Zivilisation ist in Gefahr und muss jetzt Atomkraft nutzen – die einzig sichere, verfügbare Energiequelle – oder die Strafen unseres Planeten erleiden.“
Erneuerbare Energie ist im Aufwind, deckt aber weniger als ein Drittel des globalen Bedarfs. Dieser wächst mit mehr Geräten und der Umstellung auf E-Mobilität. Das Hauptproblem von Erneuerbaren: ihre Intermittenz. Batterietechnologie hilft, schwankt aber noch zu wenig, besonders in Großbritannien.
Bis dahin sollte Atomkraft eine Brückenlösung sein, so ein Papier von Morningstar und Sustainalytics (2017) mit dem Titel„Atomkraft und ESG: Können sie zusammen spielen?"„Der Erhalt der bestehenden Atomflotte ist der schnellste Weg, US-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen.“
Viertgenerations-Atomkraftwerke innovieren. Die kanadische Terrestrial Power Energy nutzt Wasser statt Salz als Kühlmittel, spart Wasser, vermeidet Wasserstoffbildung und Dampfexplosionen. Bill Gates' TerraPower arbeitet an Anlagen, die ihren Abfall als Brennstoff recyceln. NuScale entwickelt kleine modulare Reaktoren mit passiver Kühlung.
Diese Fortschritte haben die öffentliche Meinung kaum beeinflusst. Assetmanager und Regulierer sind unsicher im Umgang mit dem Atom-Dilemma.
Herausforderungen globaler Standards
Die EU startete 2018 den Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Der technische Expertengruppe folgte der Taxonomie-Bericht (2020). Er schloss Atomkraft aus, obwohl er nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten definieren sollte.
Im September 2020 erklärte die EU Technologie neutralität in der Strategie für nachhaltiges Wachstum. Sieben EU-Staaten forderten jedoch im März alle Wege zur Klimaneutralität. Das Joint Research Centre der EU befand im selben Monat, Atomkraft verdiene grünes Licht für nachhaltige Investitionen.
Im April nahm die EU Atomkraft in einen delegierten Rechtsakt der EU-Taxonomie auf, ebenso Erdgas. 15 Minister aus Frankreich, Finnland und Tschechien forderten im Oktober die Aufnahme in die Haupt-Taxonomie.
„Atomenergie muss Teil der Lösung sein“, so die Minister. „Erneuerbare sind wichtig, aber wir brauchen weitere CO2-freie Quellen für konstante Versorgung. Atomkraft ist essentiell und liefert fast die Hälfte des CO2-freien Stroms Europas.“
Diese Politikerdruck ändert wenig an der Opposition in Deutschland. Detlef Glow von Refinitiv fordert globale Konsensstandards für Nachhaltigkeit und ESG-Berichterstattung. Höhere Standards gibt es national, aber kein globales Minimum.
Er ist optimistisch: Früher war Finanzberichterstattung uneinheitlich, heute gibt es IFRS. Bald könnte ein ähnlicher Rahmen für ESG-Berichterstattung folgen, dank der International Sustainability Standards Board (ISSB).
Glow warnt: „Ohne allgemeine ESG-Standards gibt es unterschiedliche Meinungen. Atomkraft ist ein Paradebeispiel. Selbst mit Definitionen werden Anleger unterschiedliche Ansichten haben, da ESG-Kriterien persönlich sind. Klare Definitionen helfen aber, Standards zu setzen.“
Nachteil für Vorreiter?
Globale Standards müssen von intergouvernementalen oder gemeinnützigen Gruppen kommen. Die europäische ETF-Industrie meidet kontroverse Themen wie Atomkraft. BNP Paribas Asset Management und Deka lehnten eine Stellungnahme ab.
Lamont meint: „ETF-Anbieter sollten Stellung beziehen, doch die meisten wollen nicht vom Rudel abweichen. Deshalb wird eine zentrale Autorität gesucht. Sie wollen keine Entscheidungen treffen, um keine Anleger zu verprellen. Die Vermögensverwaltung ist konservativ. Wenige Portfolio-Manager werden sich stark zu Atomkraft positionieren. Der Nutzen ist den Aufwand nicht wert.“
ETF-Anbieter meiden lieber Konflikte und schließen Atomkraft aus ESG-Produkten aus. „Wie eine vegane Option im Restaurant“, erklärt Lamont. „Wenige Kunden, wenig Aufwand. Ähnlich bei Atomkraft. Wenige wären verärgert über eine Aufnahme, aber das reicht, um sie nicht anzubieten.“
Der MSCI World Index bietet 1,75 % Atomkraft-Exposure. Der MSCI World ESG Screened behält etwas, der MSCI World ESG Leaders schließt den Sektor aktiv aus.
Bei spezialisierten Produkten sieht es anders aus. Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG) hält 14 % an Atomkraft-Unternehmen. Der Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (XGBE) weist 17 % zu.
Lamont begrüßt die Vielfalt: „Beide Seiten der Atomdebatte haben legitime Ansichten, Produkte sollten Anlage-Überzeugungen abbilden.“ Für manche ETF-Anbieter sei die Aufnahme von Atomkraft in gemischte ESG-ETFs oder spezielle Themen-ETFs, die die Energiewende thematisieren, eine logische Entscheidung.
Verwandte Artikel: