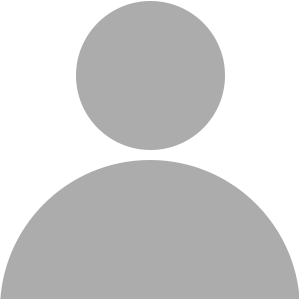Synthetische ETFs waren vor der globalen Finanzkrise (GFC) eine beliebte Option für Produktanbieter. Das damit verbundene Kontrahentenrisiko galt bestenfalls als theoretisch.
Die Preisvorteile durch eine günstigere Quellensteuerbehandlung für US-Bestände waren ein zu überzeugendes Argument, um es zu ignorieren.
Gemäß Section 871(m) des HIRE Act sind synthetische Indizes mit tiefen und liquiden Futures-Märkten von der Verpflichtung zur Zahlung von Quellensteuern auf Dividenden explizit ausgenommen.
Physische ETFs mit Sitz in Irland unterliegen hingegen einer Quellensteuer von 15 % auf US-Dividenden, während andere Jurisdiktionen wie Luxemburg 30 % zahlen.
Da das Kontrahentenrisiko von Derivaten während der GFC in den Mittelpunkt rückte, scheinen diese Vorteile für Anleger an Reiz verloren zu haben.
Warnungen des Internationalen Währungsfonds, die synthetische ETFs als potenzielle Quelle von Instabilität in turbulenten Marktphasen diskreditierten, scheinen nach wie vor nachzuhallen. Der Marktanteil synthetischer ETFs fiel daher von rund 40 % vor 2008 auf heute weniger als 15 %.
In der Erwartung, dass mehr Anleger bereit sind, ihre Auswahlprozesse zu überdenken, sahen wir kürzlich einige vielversprechende Neuemissionen synthetischer ETFs von Branchenriesen wie BlackRock.
Da die eingebetteten Swaps nun oft auf verschiedene Kontrahenten aufgeteilt sind, sind die Risiken ausgewogener als in der Vergangenheit.
Ein positiver Nebeneffekt: Swaps werden heutzutage nur nach Wettbewerb unter Banken zum besten Preis gehandelt. Daher haben sich auch die wirtschaftlichen Konditionen dieser Swaps verbessert.
Ein struktureller Steuervorteil, ein ausgeglicheneres Kontrahentenrisiko und eine verbesserte Preisgestaltung sollten ein zu verlockendes Rezept sein, zumindest theoretisch.
Was bisher in der Diskussion ignoriert wird, sind die versteckten Reputationsrisiken, die sich aus der Art der in ETFs verwendeten Swaps ergeben.
Diese könnten jeden anderen Vorteil bei weitem überwiegen und der Hauptbremsklotz für synthetische ETFs sein, die zu ihrem früheren Glanz zurückkehren wollen.
Normalerweise handelt es sich bei synthetischen ETFs um Swaps, bei denen vereinbart wird, dass der Swap-Kontrahent die Indexrendite einschließlich aller Dividendenzahlungen an den ETF zahlt.
Im Gegenzug erhält der Swap-Kontrahent eine Gebühr und die Rückgabe der Wertpapiere in einem Collateralportfolio.
Daher sind die Gelder eines synthetischen ETFs nicht im replizierten Index selbst investiert, sondern in einem Wertpapierkorb, der als Sicherheit für den Swap-Kontrahenten dient.
Das Collateralportfolio stimmt kaum mit dem replizierten Index überein. Beispielsweise kann ein synthetischer ETF auf europäische Aktien auch japanische Aktien im Collateralportfolio halten.
Die Zusammensetzung des Korbes wird in der Regel von den Finanzierungsbedürfnissen des Swap-Kontrahenten bestimmt.
Hier beginnt (potenziell) der Ärger. Zwar gibt es einige grundlegende Kriterien für die Akzeptanz von Sicherheiten, doch die Zusammensetzung eines Sicherheitenkorbs unterliegt ständigen Änderungen.
Dies kann zu Situationen führen, in denen Unternehmen (z. B. Ölproduzenten), die die Verpflichtungen des ETFs oder der Anbieter in Bezug auf Principal Adverse Impacts (PAI) nicht erfüllen, Teil des Sicherheitenkorbs sein könnten. PAIs sind durch die EU-Verordnung über nachhaltige Finanzoffenlegung (SFDR) definierte negative Auswirkungen einer Anlageentscheidung auf eine ESG-Herausforderung.
ESG-bezogene Fonds (Artikel 8 und 9 der SFDR) berücksichtigen mindestens die meisten der 18 bestehenden PAIs. Die Haltung von Sicherheiten, die nicht mit der PAI-Verpflichtung übereinstimmen, kann bereits eine Reputationsgefahr für den Produktanbieter darstellen. Gleiches gilt für den Produktvertreiber.
Eine steigende Zahl von Banken und Vermögensverwaltern verpflichtet sich, diese PAIs zu berücksichtigen und keine Unternehmen oder Vermögenswerte zu fördern, die dies nicht tun.
Technische Experten werden sich vielleicht wundern, wo das Problem liegt. Das Collateralportfolio ist nur eine Sicherheit.
Der ETF trifft keine aktive Anlageentscheidung und ist wirtschaftlich nicht in diese Unternehmen investiert. Seine wirtschaftliche Anlage ist nach wie vor ausschließlich im abgebildeten Index.
Es gibt jedoch auch eine Denkschule, die argumentiert, dass bereits die Möglichkeit, diese „ESG-unfreundlichen“ Aktien als Sicherheit zu nutzen, zu den Finanzierungsbedürfnissen der betreffenden Unternehmen beiträgt.
Dieses Argument wird oft von Umweltaktivisten im Zusammenhang mit Greenwashing-Vorwürfen verwendet.
Aufgrund der Sensibilität des Themas möchte man die Verbindung zu Greenwashing so weit wie möglich vermeiden. Fondsadministratoren müssen ihre Optionen abwägen, um mit dem Risiko von Anschuldigungen umzugehen.
Mögliche Lösungen
Erstens, nichts tun und die wirtschaftliche Beteiligung des ETFs als Hauptmaßstab für die Erfüllung bestimmter ESG-Richtlinien anführen. Obwohl dies theoretisch haltbar erscheint, sind die Reputationsrisiken bemerkenswert.
Um sich gegen mögliche Anschuldigungen in einem solchen Fall zu verteidigen, müssen sehr technische Details der Swap-Mechanismen diskutiert werden. Diese können eine schwache Verteidigung gegen eine hypothetische Schlagzeile wie „Big Oil in ESG-ETFs – Greenwashing geht weiter“ darstellen.
Die zweite Option wäre die Implementierung laufender Kontrollen zur Überwachung des Collateralportfolios.
Während dies für den Anbieter relativ einfach (aber potenziell kostspielig) ist, könnte es für Vertreiber wesentlich schwieriger sein. Denken Sie daran, dass für den Käufer des ETFs die Zusammensetzung des Collaterals und die damit verbundenen Anforderungen im Voraus unbekannt sind und sich ständig ändern können.
Die Einrichtung effektiver Kontrollen für das Collateralportfolio kann daher für kleinere Käufer kostspielig oder sogar unmöglich sein.
Daher wäre die einzige „wasserdichte“ Lösung darauf zu bestehen, dass der ETF-Anbieter entsprechende Filter in den Swap-Bedingungen in Bezug auf die zulässigen Wertpapiere als Sicherheit aufnimmt.
Aber auch unter diesen Umständen müsste jeder Käufer wahrscheinlich immer noch Kontrollen implementieren, um sich nicht ausschließlich auf die Einschätzung des Anbieters zu verlassen.
Die dritte Option besteht offensichtlich darin, zu dem Schluss zu kommen, dass trotz der unbestreitbaren Performance-Vorteile synthetischer ETFs das eingebaute Reputationsrisiko und der erforderliche Aufwand zur Risikominderung es möglicherweise nicht wert sind.
Wenn man so will, wäre dies die Anerkennung einer asymmetrischen Risiko-Rendite-Situation, da eine Schlagzeile wie „Bank verzichtet auf 15 Basispunkte Performance wegen Nichtnutzung synthetischer ETFs“ weitaus weniger Aufsehen erregt.
Stephan Kemper ist Chef-Anlagestratege, Teamleiter Advisory Desk, und Kolja Wagner ist Finanzproduktberater für nachhaltige Anlagen bei BNP Paribas Wealth Management.
Dieser Artikel erschien erstmals in ETF Insider, dem monatlichen ETF-Magazin von ETF Stream für professionelle Anleger in Europa. Um die vollständige Ausgabe zu lesen,klicken Sie hier.