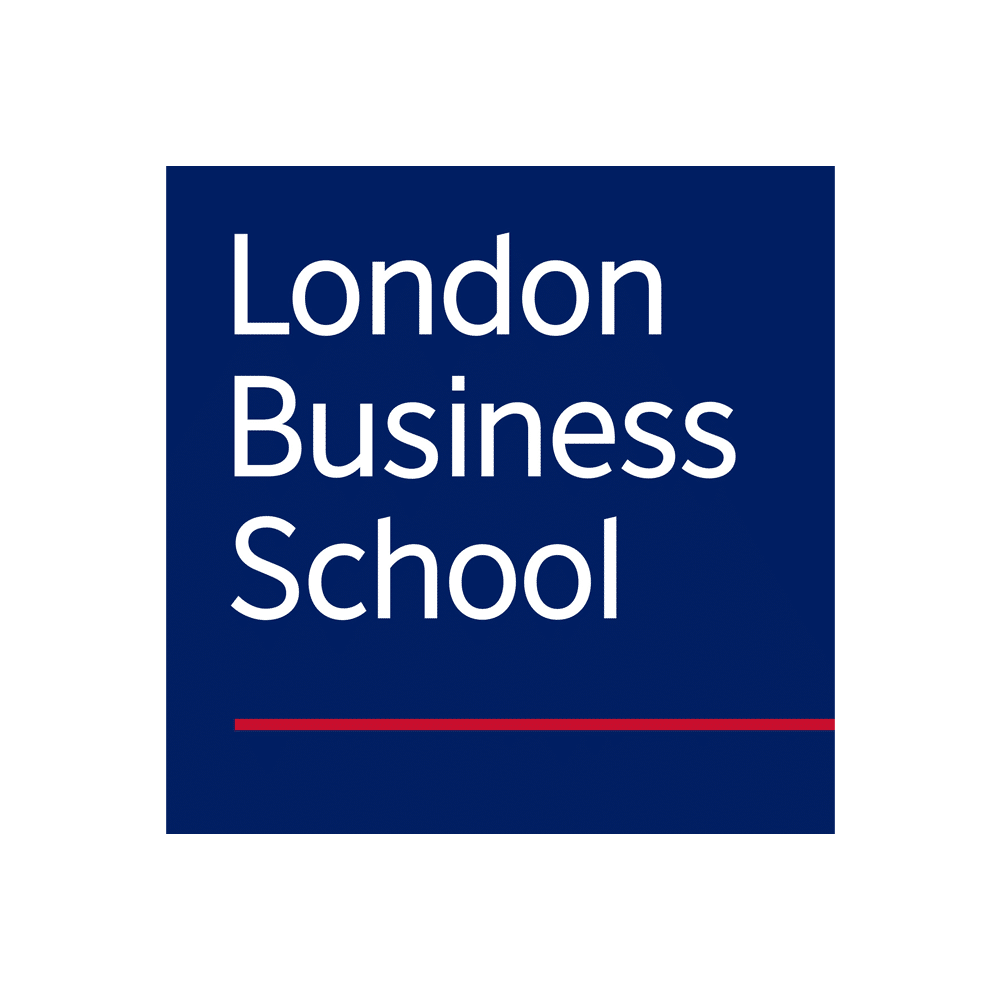Alex Edmans, Finanzprofessor an der London Business School, erklärt, warum Anleger ihre Mentalität des Kuchenteilens durch eine des Kuchenwachstums ersetzen müssen und warum nur bestimmte ESG-Faktoren zu Outperformance führen.
Der Kapitalismus steckt in der Krise. Politiker, Bürger und sogar Manager weltweit sind sich einig: Die Wirtschaft dient den einfachen Menschen nicht mehr. Sie bereichert die Eliten und achtet kaum auf Löhne, Kundenwohl oder den Klimawandel.
Bürger und ihre Vertreter wehren sich. Die Reaktionen sind vielfältig: Occupy-Bewegungen, Brexit, populistische Führer, Handels- und Einwanderungsbeschränkungen und Proteste gegen Managergehälter. Doch die Stimmung ist dieselbe: „Sie“ profitieren auf Kosten von „uns“.
Radikale Reformforderungen stoßen auf viel Unterstützung. Sie drohen jedoch, das Kind mit dem Bade auszuschütten und ignorieren die entscheidende Rolle von Gewinnen für die Gesellschaft. Gewinne werden oft als böse Wertvernichtung dargestellt. Ohne Gewinne finanzieren Aktionäre jedoch keine Unternehmen, Unternehmen keine Investitionen und Investitionen nicht die Bedürfnisse der Aktionäre.
Aktionäre sind keine namenlosen, gesichtslosen Kapitalisten. Dazu gehören auch Eltern, die für die Ausbildung ihrer Kinder sparen,Pensionsfonds, die für ihre Rentner investierenoder Versicherungen, die zukünftige Schäden finanzieren. Anleger sind nicht „die Anderen“, sie sind „wir“. Jedes ernsthafte Reformkonzept muss Anlegern und Gesellschaft dienen.
Kuchenwachstum oder Kuchenteilung?
Anleger als „die Anderen“ und die Gesellschaft als „wir“ zu betrachten, ist ein Beispiel für die Kuchenteilungs-Mentalität. Sie sieht den von einem Unternehmen geschaffenen Wert als festen Kuchen. Jeder Anteil, der an das Unternehmen geht, verringert den Anteil der Gesellschaft. In diesem Sinne wird der Gesellschaft am besten geholfen, wenn man Unternehmen einschränkt, damit sie nicht zu viel Gewinn machen.
Die Kuchenteilungs-Mentalität praktizieren auch viele Anleger. Sie glauben, Gewinne steigern zu können, indem sie die Gesellschaftsanteile kürzen: Wucherpreise für Kunden oder Ausbeutung von Mitarbeitern. Ein Unternehmen, das das Wohl der Stakeholder ernst nimmt, gilt als „fluffig“ und vom Kerngeschäft abgelenkt.
Costco zahlte seinen Mitarbeitern fast das Doppelte des nationalen Durchschnitts (bis Wettbewerber kürzlich die Löhne erhöhten). 90 % erhalten Krankenversicherung, teilweise auch Teilzeitkräfte nach sechs Monaten. Costco schließt an allen wichtigen US-Feiertagen, auch wenn diese profitabel sein könnten, damit Mitarbeiter bei ihren Familien sein können.
Diese Maßnahmen sind kostspielig und treiben manche Aktienanalysten und Investoren zur Verzweiflung. Ein Analyst klagte laut BusinessWeek: „Costco managt sich zulasten der Aktionäre auf Mitarbeiter. Warum sollte ich eine solche Aktie kaufen?“ Der Titel eines Artikels im Wall Street Journal fasst die Vorstellung eines festen Kuchens zusammen: „Costcos Dilemma: Nett zu seinen Arbeitern oder zur Wall Street?“ Das entscheidende Wort ist „oder“.
Doch der Kuchen ist nicht fix. Die Kuchenwachstums-Mentalität betont, dass Investitionen in Stakeholder den Kuchenanteil der Anleger nicht schmälern. Sie vergrößert den Kuchen und nützt letztlich den Anlegern.
Ein Unternehmen mag Arbeitsbedingungen aus Sorge um Mitarbeiter verbessern; diese werden motivierter und produktiver. Ein Unternehmen entwickelt ein Medikament gegen eine Gesundheitskrise, ohne die Zahlungsfähigkeit der Betroffenen zu prüfen, und vermarktet es erfolgreich. Ein Unternehmen reduziert Emissionen weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus aus Verantwortungsgefühl, und gewinnt Kunden, Mitarbeiter und Investoren, die solche Werte schätzen.
Bei der Kuchenwachstums-Mentalität dient das Unternehmen primär der Gesellschaft, nicht dem Profit. Überraschenderweise ist dieser Ansatz oft profitabler, als wenn Profit das Ziel wäre. Er ermöglicht Investitionen, die langfristig erhebliche Erträge bringen.
Ein rein gewinnorientiertes Unternehmen investiert zwar auch in Stakeholder – aber nur, wenn die kalkulierten Gewinne die Kosten übersteigen. Investitionsentscheidungen basieren laut Lehrbüchern auf Kosten-Nutzen-Analysen.
Doch das reale Leben ist kein Lehrbuch. Die zukünftigen Erträge einer Investition zu berechnen, ist oft schwierig. Früher war das einfacher bei Sachanlagen: Ein neues Werk liefert schätzbare Stückzahlen und Umsätze.
Der Wert eines Unternehmens im 21. Jahrhundert stammt meist aus immateriellen Vermögenswerten wie Marke und Unternehmenskultur. Verbessert ein Unternehmen die Arbeitsbedingungen, ist unmöglich abzuschätzen, wie viel produktiver die Mitarbeiter werden und wie sich das auf den Gewinn auswirkt.
Ähnliches gilt für den Reputationsvorteil einer guten Umweltbilanz. Ein Unternehmen, das nicht jede Investition rechnerisch rechtfertigen muss, investiert mehr und wird letztlich profitabler.
Beweise
Wenden wir uns den Fakten zu. Die Idee, dass Unternehmen und Gesellschaft profitieren können, klingt wie ein zu schöner Traum. Doch fundierte Beweise zeigen: Unternehmen, die ihre Stakeholder gut behandeln, erzielen überlegene langfristige Renditen für Anleger.
Eine meiner Studien zeigt, dass Unternehmen mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit – gemessen an der Aufnahme in die Liste der 100 besten Arbeitgeber Amerikas – ihre Wettbewerber über 28 Jahre um 2,3 % bis 3,8 % pro Jahr übertrafen. Das sind 8 % bis 184 % kumuliert.
Weitere Tests deuten darauf hin, dass die Mitarbeiterzufriedenheit die Leistung bedingt und nicht umgekehrt. Andere Studien finden ebenfalls Zusammenhänge zwischen Kundenzufriedenheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeitspolitik mit höheren Aktienrenditen.
Wichtig: Diese Maßnahmen sozialer Verantwortung sind öffentlich zugänglich. Wäre der Markt effizient, wären sie bereits im Aktienkurs enthalten, und Anleger könnten damit kein Geld verdienen. Doch da viele Anleger die Kuchenteilungs-Mentalität verfolgen und glauben, diese Maßnahmen gingen zulasten des Shareholder Value, ignorieren sie sie.
Tatsächlich übertrafen die Quartalsgewinne der „Best Companies“ systematisch die Analystenerwartungen. Dies deutet darauf hin, dass die Mitarbeiterzufriedenheit die Produktivität steigerte, der Markt dies aber nicht einkalkulierte und die Gewinne unterschätzte.
Implikationen für Anleger
Was bedeutet das alles für Anleger? Ich betone drei Punkte. Erstens: Die Rolle der Anleger bei der Unternehmensreform. Anleger werden oft als Feinde betrachtet, die Profite auf Kosten der Gesellschaft erwirtschaften.
Ein Buch behauptete, „Aktionärsaktivisten sind eher wie Terroristen, die durch Angst agieren, die grundlegenden Vermögenswerte des Unternehmens ausweiden und alles Bargeld extrahieren, was andernfalls langfristigen Wert schaffen würde“. Politiker in Großbritannien und den USA schlugen vor, die Anlegerrechte einzuschränken.
Doch diese Ansichten entbehren jeder Evidenz. Fundierte Studien zeigen: Aktionärsaktivismus steigert zwar Gewinne, aber nicht durch Kuchenteilung, sondern durch Kuchenwachstum – verbesserte Produktivität und Innovation, was wiederum der Gesellschaft zugutekommt. Jede Neuausrichtung des Kapitalismus sollte daher das Engagement der Anleger in den Mittelpunkt stellen, wie es der neue UK Stewardship Code vorsieht. Zweitens: Die Rolle von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen. ESG-Investitionen gelten oft als Nischenbereich, nur für Anleger mit sozialer Mission, da soziale Leistung auf Kosten von Profiten gehe. Stattdessen ist die Integration dieser Dimensionen eine gute Praxis für alle Anleger, auch für jene mit rein finanziellen Zielen.
ETF-Einblick: Können ESG-Anleger Gutes tun und gleichzeitig eine Unterperformance vermeiden?
Gute Unternehmen sind nicht immer gute Investments. Wenn ein Unternehmen gut ist und jeder das weiß, zahlt der Anleger den Preis. Es ist sinnlos, Facebook zu kaufen, weil es führend im Social Media ist – das weiß jeder, also sind die Aktien teuer. Ein gutes Investment ist ein Unternehmen, das besser ist, als alle denken. Stakeholder-Kapital ist ein Paradebeispiel für solch einen Schatz: Es führt zu Gewinnen, die der Markt aber wegen der Kuchenteilungs-Mentalität nicht erkennt.
Die dritte Implikation ist differenzierter. Obwohl ESG-Investitionen nicht auf Kosten von Gewinnen gehen,ist es wichtig, nicht zu weit in die andere Richtung zu gehen. Manche ESG-Befürworter übertreiben und behaupten, ESG-Investitionen seien ein Allheilmittel. Ein Artikel der Financial Times meinte: „Die Outperformance von ESG-Strategien steht außer Frage“, und ein führender britischer Broker behauptete kürzlich: „Studie um Studie hat gezeigt, dass Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen ihre schlechter platzierten Wettbewerber übertroffen haben“.
Diese Behauptungen werden oft unkritisch akzeptiert, begünstigt durch Bestätigungsfehler – die Versuchung, „Beweise“ als wahr anzunehmen, wenn sie dem Wunschdenken entsprechen. Wir alle möchten in einer Welt leben, in der ethische Unternehmen besser abschneiden. Doch nur bestimmte ESG-Faktoren sind mit überlegener finanzieller Performance verbunden.
Welche Faktoren? Jene, die auf Kuchenwachstum basieren. Manche ESG-Investitionen basieren auf Kuchenteilung – die Idee, dass ein verantwortungsvolles Unternehmen nicht zu viel Gewinn an Aktionäre (oder Manager) ausschüttet, sondern ihn an Stakeholder umverteilt. Manche ESG-Investoren nutzen das Verhältnis von CEO- zu Arbeitnehmergehältern als Kriterium und glauben, ein zu hohes Verhältnis deute darauf hin, dass der CEO zu viel vom Kuchen stiehlt.
Die Beweislage zeigt jedoch, dass Gehaltsverhältnisse positiv mit langfristigen Aktienrenditen korreliert sind. Stattdessen sollte die Gehaltsreform darauf abzielen, den CEO für das Kuchenwachstum zur Rechenschaft zu ziehen. Dies hängt nicht von der Höhe des Gehalts ab, sondern von dessen Struktur.
Hält sie einen erheblichen Anteil an Eigenkapital, wird sie nur belohnt, wenn der Kuchen wächst; schrumpft er, schrumpft ihr Vermögen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Unternehmen mit hoher CEO-Eigenkapitalbeteiligung sie mit 4 %-10 % pro Jahr übertreffen. Weitere Tests deuten darauf hin, dass die hohe CEO-Beteiligung die Leistung der Unternehmen verursacht und nicht rosige Zukunftsaussichten, die CEOs dazu veranlassen, heute mehr Aktien zu halten.
Das Geschäftsleben muss reformiert werden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Die Reformen sollten jedoch nicht darin bestehen, Unternehmen zu regulieren, um sie weniger profitabel zu machen. Stattdessen müssen CEOs und Investoren ihre Verantwortung gegenüber den Stakeholdern ernst nehmen und Gewinne nur als Nebenprodukt der Bedienung der Gesellschaft anstreben, anstatt Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt auszubeuten. Gesellschaftlichen Wert zu schaffen ist nicht nur „lohnend“ – es ist gutes Geschäft. Die hochwertigsten Beweise, nicht Wunschdenken, führen zu diesem Schluss: Um das Land des Profits zu erreichen, folgen Sie dem Weg des Zwecks.
Alex Edmans ist Professor für Finanzen an der London Business School und Autor von „Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit“.
Dieser Artikel erschien erstmals in der Ausgabe 4/2019 unserer neuen Publikation Beyond Beta. Für eine vollständige Ausgabe, klicken Sie hier.