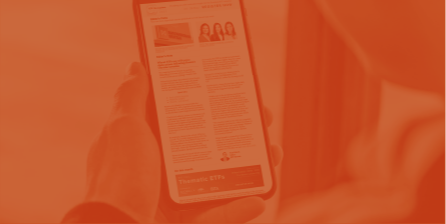Der Aufstieg des Faktor-Investings
Von der Wissenschaft zum ETF
Smart-Beta-ETFs zielen darauf ab, bestimmte Renditetreiber – sogenannte Faktoren – wie Value oder Momentum systematisch abzubilden. Diese Faktoren sollen langfristig zu überdurchschnittlichen, risikoadjustierten Renditen führen.
Das Konzept des Faktor-Investings hat seine Wurzeln in den 1930er Jahren. Schon Benjamin Graham und David Dodd betonten in ihrem Klassiker „Security Analysis“ die Bedeutung von Unternehmen, deren Marktwert unter ihrem inneren Wert liegt – der Ursprung des Value-Faktors.
In den 1970er Jahren wurde der Faktor-Ansatz erstmals wissenschaftlich dokumentiert. Den entscheidenden Durchbruch brachte jedoch das Drei-Faktoren-Modell von Eugene Fama und Kenneth French in den 1990er Jahren. Es identifizierte Marktrisiko, Unternehmensgröße (Size) und Bewertung (Value) als Haupttreiber für mögliche Überrenditen gegenüber dem Gesamtmarkt.
Smart-Beta-ETFs: Faktoren regelbasiert umsetzen
Im Laufe der Zeit haben Forscher und Investoren weitere Faktoren wie Momentum, Low Volatility und Quality identifiziert, die zur Erklärung von Renditeunterschieden beitragen. Zu den fünf wichtigsten zählen:
• Value: Aktien von Unternehmen, die gemessen an Fundamentaldaten unterbewertet erscheinen.
• Momentum: Aktien mit einer starken jüngeren Kursentwicklung, deren Trend sich fortsetzen könnte.
• Quality: Unternehmen mit solider Bilanz, stabilem Gewinnwachstum und hoher Kapitalrendite.
• Low Volatility: Aktien, die geringeren Schwankungen unterliegen, insbesondere in turbulenten Marktphasen.
• Size: Aktien kleinerer Unternehmen (Small Caps), die langfristig höhere Renditen bieten können.
Multi-Faktor-ETFs
Die akademische Forschung zeigt, dass diese Faktoren über Konjunkturzyklen hinweg tendenziell besser abschneiden als klassische, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Um davon zu profitieren, entwickelten Vermögensverwalter ETFs, die gezielt auf einzelne oder mehrere dieser Faktoren setzen. Diese Produkte sind unter dem Begriff Smart-Beta-ETFs bekannt.
Einige Anbieter gehen noch einen Schritt weiter und kombinieren mehrere Faktoren in einem Portfolio – sogenannte Multi-Faktor-ETFs. Je nach Indexanbieter werden die Gewichtungen der einzelnen Faktoren so gestaltet, dass sie sich gegenseitig ergänzen und die Volatilität des Gesamtportfolios senken.
Smart-Beta-ETFs werden oft als Brücke zwischen aktivem und passivem Investieren beschrieben. Sie folgen einem festen Regelwerk wie klassische Indexfonds, streben aber durch gezielte Faktorstrategien an, Alpha bzw. eine Outperformance gegenüber dem Markt zu generieren – im Gegensatz zu traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs.
Fazit
Kritiker bemängeln jedoch, dass Smart-Beta-ETFs häufig keine spürbar höheren Renditen erzielen als herkömmliche Indexfonds und die Wahl eines bestimmten Faktors selten einen klaren Mehrertrag bringt.
Zwar liegen ihre Gebühren meist über denen klassischer passiver ETFs, doch bleiben sie in der Regel günstiger als aktiv gemanagte Fonds.
Wichtigste Erkenntnisse
Smart-Beta-ETFs ermöglichen Anlegern, Faktoren für eine risikobereinigte Outperformance zu nutzen.
Die fünf gängigsten Faktoren sind Value, Qualität, niedrige Volatilität, Momentum und Größe.
Smart-Beta-ETFs gelten oft als Brücke zwischen aktivem und passivem Investieren.