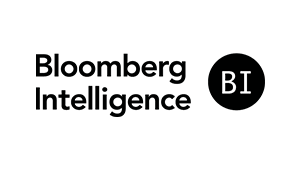Offene ETFs können Marktsegmente präzise abbilden – auch die kleineren. Doch Pacer ETFs musste nun feststellen: Die Abgrenzung des kleinsten Marktsegments wird zur Herausforderung, wenn ein ETF selbst zu groß wird.
Der Anbieter aus Pennsylvania hat sich darauf spezialisiert, den traditionellen „Value“-Ansatz – den Kauf von Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis – infrage zu stellen. Stattdessen setzt er auf Unternehmen mit hoher Free-Cashflow-Rendite.
Diese Strategie fand reißenden Absatz, als die US-Notenbank die Zinsen so stark anhob wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Zwischen Anfang 2022 und Mai vergangenen Jahres flossen fast 8,5 Milliarden US-Dollar in den Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Eine UCITS-Variante folgte im Januar.
Damit begann eine vertraute Geschichte: Der ETF hielt zu große Anteile an vielen seiner Basiswerte – ein klassisches Opfer seines eigenen Erfolgs. Eine komplette Überarbeitung wurde nötig. Das Portfolio wurde verdoppelt, das Anlageuniversum verdreifacht, eine neue Marktkapitalisierungsgrenze auf Basis des Streubesitzes eingeführt.
Vernünftige Maßnahmen unter den gegebenen Umständen – mit spürbaren Folgen. Anleger sehen sich nun einem Fonds mit völlig anderer Ausrichtung gegenüber. Das Portfolio ist nicht nur doppelt so groß; keiner der ursprünglichen Top-10-Werte ist noch enthalten. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Titel stieg von 3,9 Milliarden auf knapp das Vierfache. Klein bleibt der Fonds also nur dem Namen nach.
Besorgniserregender ist, dass CALF ein weiteres Beispiel für einen ETF ist, der mit seiner Größe die Märkte kleiner Unternehmen durcheinanderbringt – und sie beim Rebalancing regelrecht verbrennt.
Als der Index im März neu aufgesetzt wurde, fielen die Kurse von sieben der zehn größten Positionen. Die passiven Beteiligungen schrumpften im Schnitt um 11,5 %, berichtet Bloomberg Intelligence.
Am härtesten traf es die frühere Top-Position Central Garden & Pet Company, einen unscheinbaren Konsumgüterhersteller aus Walnut Creek, Kalifornien. Rund 40 Jahre nach seiner Gründung hielt CALF über 23 % der Anteile – der passive Besitzanteil stieg auf 60 %. Binnen weniger Monate fiel diese Quote auf 1,1 % beziehungsweise 33 %.
Diese Entwicklung – verbunden mit abnehmender Inflationsdynamik – ließ das Fondsvermögen bis Redaktionsschluss auf 3,9 Milliarden US-Dollar sinken.
Es ist nicht das erste Mal, dass ETFs unfreiwillig zum Verursacher von Turbulenzen in den unteren Marktsegmenten werden.
Kurz bevor CALF seine Kapazitätsgrenzen überschritt, berichtete ETF Stream über ein ähnliches Szenario beim VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GDXJ). Gemeinsam mit seiner US-Schwesterstrategie erreichte er ein verwaltetes Vermögen von über 4,1 Milliarden US-Dollar.
Kleine Goldminen sind ein naheliegendes Ziel für einen ETF: Sie bieten eine verstärkte Goldexposition, sind aber aufgrund ihrer geringen Größe und Projektabhängigkeit besonders anfällig für operative oder politische Risiken. Diversifikation erscheint hier sinnvoll – offenbar zu sinnvoll, denn zu viele Anleger folgten dieser Logik.
GDXJ bildete ursprünglich nur die kleinsten 10 % der Unternehmen im Goldsektor ab. Der Indexanbieter erhöhte die Schwelle 2014 auf 20 %, 2017 auf 40 %. Bis 2022 waren 68,6 % des Fondsvermögens in Firmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 5 Milliarden US-Dollar investiert – bei einer Beteiligungsquote von mindestens 4 % an allen fünf größten Positionen.
Ein Jahr zuvor hatten auch die Aushängeschilder der Energiewende – BlackRocks iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG) und das US-Pendant – mit 12 Milliarden US-Dollar AUM ihren Höhepunkt erreicht. Weniger als 18 Monate zuvor lagen sie noch unter einer Milliarde.
Der ETF umfasste damals lediglich 30 Aktien des S&P Global Clean Energy Index – viele davon mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde US-Dollar. Schließlich besaß der Fonds über 7 % von 12 Unternehmen .
Ein darauf folgender, erzwungener Indexwechsel führte zu massiven Umschichtungen. Allein Contact Energy musste Aktien im Wert von rund 182 Millionen US-Dollar abstoßen – ein Vorgang, der auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens etwa 13 Tage gedauert hätte.
Solche Episoden verursachen nicht nur Liquiditätsengpässe und Kursdruck, sondern sind für aufmerksame Marktteilnehmer leicht vorhersehbar – und damit ein gefundenes Fressen für Hedgefonds, die daraus Kapital schlagen. Die Zeche zahlen am Ende die ETF-Anleger.
Unsere Leser kennen diese Geschichten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die ETF-Struktur selbst ihre Grenzen erkennt – und sich künftig etwas weniger tief in die kleinsten Marktsegmente wagt.